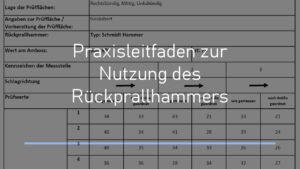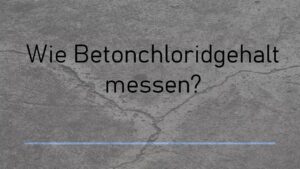
In die Tiefe gehen: Betonchloridgehalt messen für langfristige Stabilität
In die Tiefe gehen: Betonchloridgehalt messen für langfristige Stabilität Entdecken Sie die Bedeutung der Messung des Betonchloridgehalts für die Bauindustrie. Erfahren Sie mehr über verschiedene